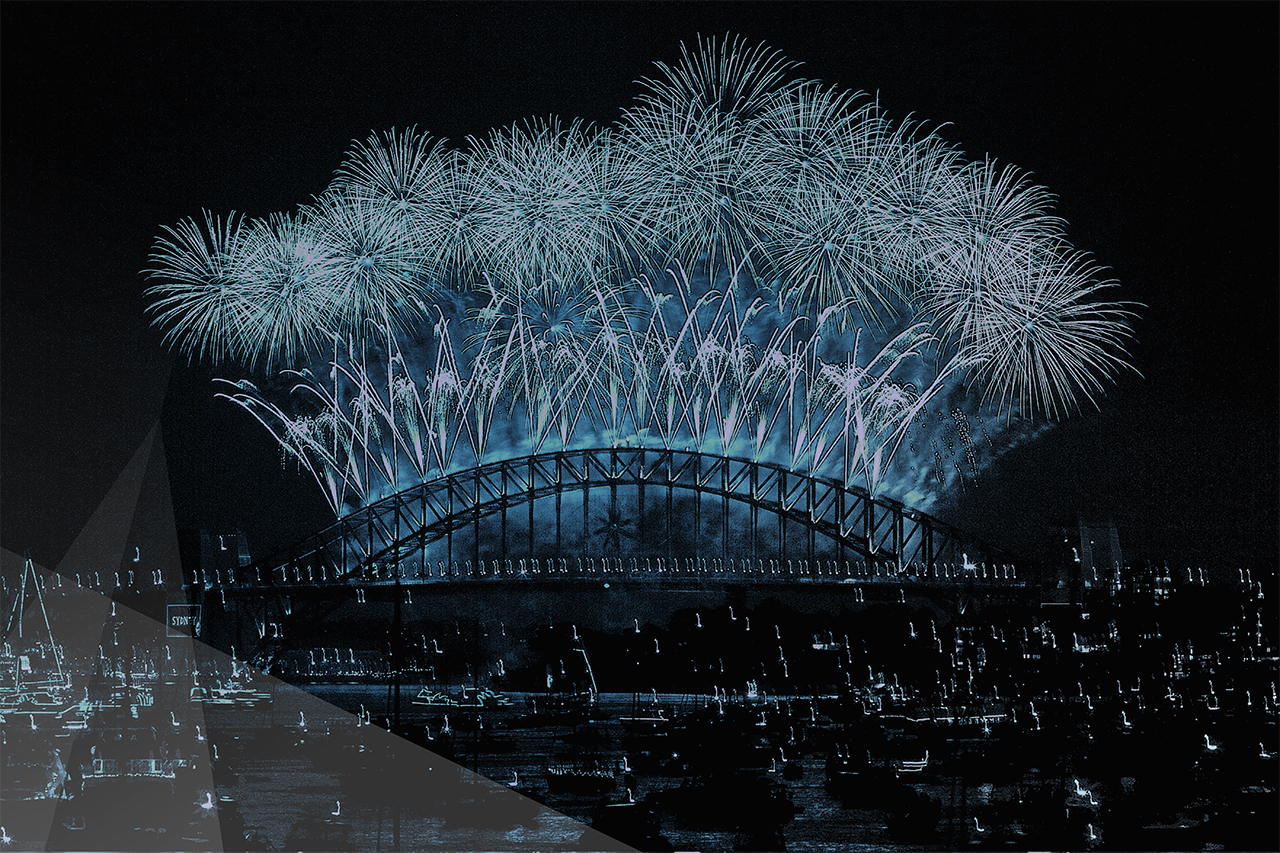Jul 28, 2025
Noch nie in der Geschichte der deutschen Sprache haben ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein Querstrich so stark die Diskussionen angeregt und zu hitzigen Debatten geführt. Die Gender-Zeichen schaffen es sogar auf die Agenda verschiedener Parteien und auf die Titelblätter grosser Zeitungen. Doch ist diese Aufregung wirklich gerechtfertigt?
In diesem Artikel wollen wir den Fokus auf die Bedeutung und den Einfluss einer geschlechtergerechten Sprache auf die verschiedenen Anspruchsgruppen legen. Besonders für jüngere Generationen nimmt diese Thematik einen hohen Stellenwert ein. Aus rein sachlichen Erwägungen sowie unter Berücksichtigung der Kommunikations- und Vermarktungsaspekte sollte demnach das Gendern als Standard für jegliche Kommunikationsmassnahme etabliert werden. Es ist eine Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung von dieser Thematik betroffen ist.
Trotzdem gibt es durchaus Meinungen, die die Verwendung von Sternchen, Doppelpunkten und Querstrichen in der deutschen Sprache kritisch sehen. Das kann entweder politische Gründe haben oder auf einer persönlichen Präferenz beruhen, die sich auf eine bewährte Tradition stützt. Doch neben diesen Sonderzeichen gibt es auch weitere Möglichkeiten, eine geschlechtsgerechte Sprache im Wording korrekt anzuwenden.
Wer entscheidet eigentlich, ob gegendert wird?
Wenn umfassende Kommunikationsstrategien oder Kommunikationsrichtlinien erarbeitet werden, ist das Wording und damit auch die Frage der geschlechtergerechten Sprache ein wichtiger Punkt. Denn es ist von zentraler Bedeutung, dass jede Kommunikationsmassnahme auf die Unternehmensphilosophie ausgerichtet ist. Allenfalls droht längerfristig ein unglaubwürdiger Auftritt.
Wir möchten die Entscheidung, ob und wie überhaupt eine geschlechtergerechte oder -neutrale Sprache genutzt werden soll, gerne der jeweiligen Belegschaft überlassen. Ein solch breit abgestützter Entscheid kann die Einführung erleichtern, das Vorleben im Alltag stärken und möglicherweise auch kritische Gruppen für die Bedürfnisse derer sensibilisieren, die sich eine Inklusion wünschen.
Wir sind der Ansicht, dass eine solche Entscheidungsfindung im Team sowohl Platz für persönliche als auch für sachliche Argumente haben muss. Denn ein Fakt ist auch, die Sprache und deren Anwendung ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Stellen Sie sie beispielsweise vor, in der Schweiz wäre bei der Arbeit nur noch Hochdeutsch erlaubt und das Dialekt würde verdrängt. Eine Massnahme, die bereits in den Schulen an der Umsetzung scheitert.
Um sicherzustellen, dass sachliche Argumente den nötigen Raum erhalten, empfehlen wir eine Unterstützung des Prozesses durch eine Entscheidungsmatrix. Wie stellt sich die Zielgruppe des Unternehmens zusammen? Welches Image möchte das Unternehmen gegen aussen vermitteln?
Inkludieren statt ausschliessen
Wie bereits angedeutet, sind die Vorteile aus rein mathematischer Sicht evident. Es spricht durchaus einiges dafür, dass sich eine geschlechtergerechte Sprache im Geschäftsalltag als konkret wertsteigernd erweist. Verschiedene Studien legen dar, dass insbesondere im Kontext des Employer Brandings die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache weibliche Kandidatinnen stärker motiviert für eine Bewerbung. Trotz möglicher Kritik am Gendern wünschen sich aber viele Unternehmen gemischte Teams, denn die Erfahrungen zeigen, dass geschlechtergemischte Teams bessere Ergebnisse erzielen und ein positives Arbeitsklima schaffen.
Falls aber die Hemmschwelle zur Nutzung von Punkten und Strichen tatsächlich hoch ist, gibt es auch andere Lösungen. Grundsätzlich existieren in der Anwendung der geschlechtergerechten Sprache folgende vier Möglichkeiten:
Beidnennung
Die häufigste Methode ist die explizite Nennung beider Geschlechter, beispielsweise «Bürgerinnen und Bürger», «Studenten und Studentinnen». Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass der Charakter eines Textes nicht angefasst wird respektive der flüssige Lesefluss erhalten bleibt. Der offensichtliche Nachteil dieser Variante, sie eignet sich nicht für kürzere Texte.
Neutralisierung
Statt geschlechtsspezifischer Begriffe können geschlechtsneutrale Begriffe verwendet werden, beispielsweise «Lehrkraft» statt «Lehrer/in», «Studierende» statt «Studenten/innen». Die Neutralisierung lässt sich aber nicht immer textlich schön umsetzen. Gerade für werberische Texte oder mit direkter Ansprache einer Zielgruppe eignet sich diese Variante nicht.
Umschreibung
In manchen Fällen kann auch eine Umschreibung die beste Lösung sein, beispielsweise «die Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen» statt «die Teilnehmer». Auch diese Variante kann einem Text den wichtigen Charakter nehmen, eignet sich aber gut für besonders sachliche Texte.
Sonderzeichen
Mit Gendersternchen, Gender-Doppelpunkt, Gender-Gap oder Unterstrich oder dem Binnen-I lässt sich eine gendergerechte Sprache durchgehend umsetzen. Der deutliche Nachteil ist aber die Verschlechterung des Leseflusses. Dafür inkludiert das Gendersternchen aber allumfassend, sowohl binäre, als auch nonbinäre Geschlechter.
Grundsätzlich können auch mehrere Varianten angewendet werden, die je nach Einsatz eines Textes mehr Freiheiten geben und die Akzeptanz der Anwendung erhöhen. Deshalb lässt sich abschliessend allgemein festhalten, dass die Inkludierung von Personen immer besser ist als der Ausschluss.
Unser Beitrag an Ihre Kommunikationsstrategie
Als PR-Agentur begleiten wir Sie vom Kommunikationskonzept bis zur Ausführung von gewünschten Massnahmen, auch bei ganz spontanen Ideen. Kontaktieren Sie uns ungeniert für ein Erstgespräch.